Vorschläge
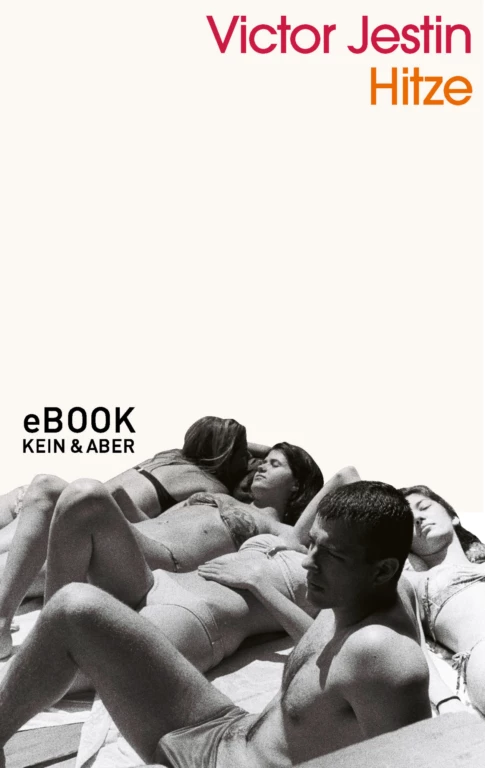
Hitze
Roman
Originaltitel: La Chaleur
Aus dem Französischen von Sina de Malafosse
Format: 160 Seiten ISBN: 978-3-0369-9442-0
Erscheinungsdatum: 12. Mai 2020
Vorschläge
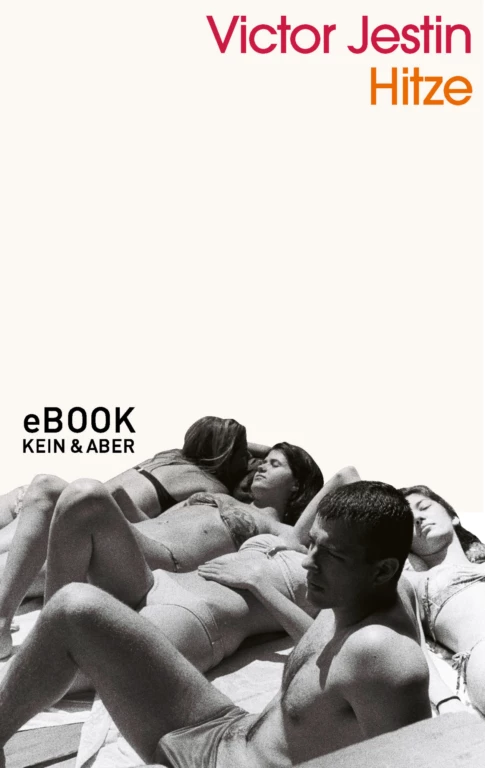
Roman
Originaltitel: La Chaleur
Aus dem Französischen von Sina de Malafosse
Format: 160 Seiten ISBN: 978-3-0369-9442-0
Erscheinungsdatum: 12. Mai 2020